Block II: Aktuelle und zukünftige Themen, Arbeits- und Aufgabenbereiche
Psychische Gesundheit — Kernthema für Prävention und Gesundheitsförderung
|
„Die Prävention psychischer Störungen ist möglich und bekommt durch die aktuellen großen gesellschaftlichen Entwicklungslinien einen weiteren Bedeutungszuwachs. Dies braucht konzertierte Aktionen von Wissenschaft, Praxis und Politik.“ Prof. Dr. Steffi G. Riedel-Heller | |
 © Stefan Straube/UKL
|
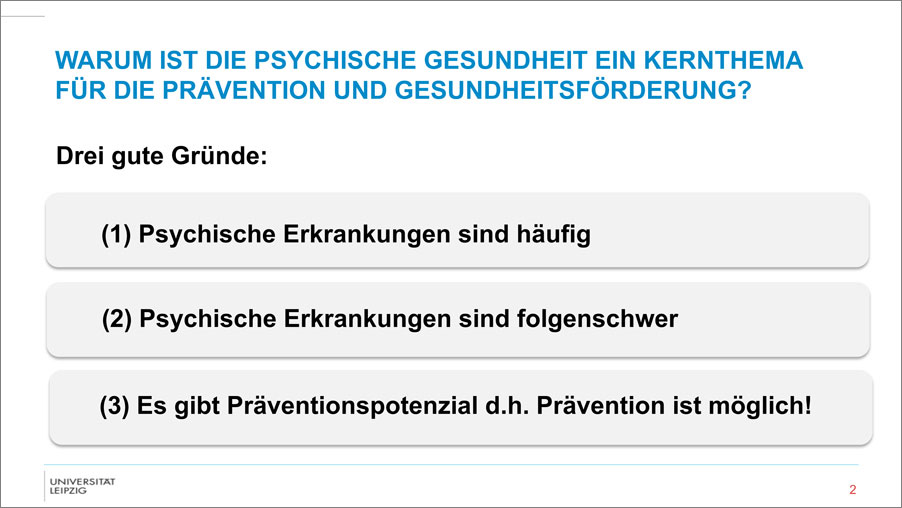
Psychische Störungen sind in der Bevölkerung häufig und folgenschwer, für den Einzelnen und für die Solidargemeinschaft. Zudem gibt es ein erhebliches Präventionspotenzial. Diese drei Fakten - Häufigkeit, Folgenschwere und ein vorhandenes Präventionspotenzial - machen die Förderung psychischer Gesundheit und die Prävention psychischer Störungen zu einem Kernthema.
Wir haben eine substanzielle Wissensbasis zu den Risiko- und Schutzfaktoren psychischer Störungen. Dabei gibt es generische Risikofaktoren, die für die große Mehrheit der psychischen Störungen gelten, wie zum Beispiel aversive Kindheitstraumata oder soziale Isolation. Wir kennen aber auch ganz spezifische Risikofaktoren, die sich auf eine bestimmte Krankheitsentität beziehen, wie zum Beispiel der Cannabisgebrauch, der das Psychose-Risiko erhöht. Verschiedene Risikofaktoren, aber auch Schutzfaktoren treffen auf Individuen mit einer mehr oder weniger großen Vulnerabilität. Insbesondere die Kenntnisse zu den modifizierbaren Risiko- und Schutzfaktoren sind die Grundlage für die Entwicklung von Maßnahmen zur Prävention psychischer Störungen und zum Erhalt der psychischen Gesundheit.
Prävention Ansätze und Gestaltungsmöglichkeiten
Davon gibt es eine Fülle. Sie können bevölkerungsweit als universelle Prävention oder bei bestimmten Zielgruppen ansetzen. Das können Zielgruppen sein, die keine Symptome aufweisen (selektive Prävention) oder schon erste Symptome zeigen (indizierte Prävention). Zudem können Maßnahmen bei der Person selbst als sogenannte Verhaltensprävention ansetzen, aber auch bei der Umwelt der Person ansetzen und diese verändern. Dann sprechen wir von Verhältnisprävention. In all diesen Bereichen gibt es wirksame Programme, die zeigen, dass die Förderung psychischer Gesundheit und Prävention möglich ist, aber auch im engeren Sinne die Neuerkrankungsrate psychischer Störungen reduziert werden kann. Die Evaluation der Maßnahmen und Programme ist wichtig, auch hier liegt ein großer Wissensschatz vor. Und nicht zuletzt ist eine Implementierung zwingend. So wie sich neue und bessere Behandlungsmethoden nicht von selbst verbreiten, finden auch präventive Interventionen selten von selbst zu den Menschen. Systeme sind träge und es bedarf gezielter Anstrengungen, um Präventionsmaßnahmen in die Breite zu bringen.
Bereits die Enquête zur Lage der Psychiatrie 1975 widmet der Primärprävention psychischer Störungen ein eigenes Kapitel. Die WHO konstatiert schon 2005, dass es keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit gibt. Das Thema ist damit nicht neu, aber brandaktuell und bekommt durch große gesellschaftliche Entwicklungslinien, so genannte Megatrends, einen weiteren Bedeutungszuwachs. Beispielhaft seien vier Megatrends genannt: 1. die Individualisierung mit dem Risiko für Einsamkeit und vermehrter sozialer Isolation, 2. der demografische Wandel („Silver Society“), die 3. Urbanisierung und last but not least 4. der Megatrend Konnektivität und Digitalisierung.
Diese gesamtgesellschaftlichen Entwicklungslinien machen deutlich, dass wir dieses Feld genauer beobachten müssen. Risiken verändern sich, wir brauchen erstklassige populationsbasierte Forschung und aktuelle zeitnahe Daten wie die Mental Health Surveillance des Robert-Koch Instituts. Wir müssen mehr in Forschung und Praxis der Prävention investieren. Die neuen gesellschaftlichen Herausforderungen bergen neue Risiken, aber auch neue Chancen für die Prävention, wie zum Beispiel skalierbare digitale Interventionen, die es zu nutzen gilt. Dazu bedarf es gemeinsamer Anstrengung von Wissenschaft, Praxis und Politik. Dabei ist Mental Health in and for All Policies (MHiAP) ein wichtiges Ziel. Von einer Präventionskultur sind wir noch weit entfernt. Diese gilt es systematisch über die gesamte Lebensspanne hinweg zu entwickeln. Public Mental Health muss als Kernstück von Public Health begriffen werden.
Quellen
- Reininghaus U, Schomerus G, Hölling H, Seidler A, Gerhardus A, Gusy B, Riedel-Heller S. „Shifting the Curve“: Neue Entwicklungen und Herausforderungenim Bereich der Public Mental Health. Psychiatr Prax. 2023 Apr;50(3):160-164. German. doi: 10.1055/a-1823-5191.
- Riedel-Heller SG, Reininghaus U, Schomerus G. Public Mental Health: Kernstück oder Stiefkind von Public Health? Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2023 Apr;66(4):356-362. German. doi:10.1007/s00103-023-03670-y.
- Thom J, Mauz E, Peitz D, Kersjes C, Aichberger M, Baumeister H, Bramesfeld A,Daszkowski J, Eichhorn T, Gaebel W, Härter M, Jacobi F, Kuhn J, Lindert J, Margraf J, Melchior H, Meyer-Lindenberg A, Nebe A, Orpana H, Peth J, Reininghaus U, Riedel-Heller S, Rose U, Schomerus G, Schuler D, von Rüden U, Hölling H. Establishing a Mental Health Surveillance in Germany: Development of a framework concept and indicator set. J Health Monit. 2021 Dec 8;6(4):34-63. doi:10.25646/8861.
Prof. Dr. Steffi G. Riedel-Heller MPH | Seit 2010 ist die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Universitätsprofessorin und Direktorin des Instituts für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health (ISAP) der Universität Leipzig. Sie forscht im Bereich Public Mental Health mit den Schwerpunkten Epidemiologie, Präventions- und Versorgungsforschung.